
Umweltbewusstsein in Deutschland | Foto: ©bernardbodo #1137941881 – stock.adobe.com
Für viele Menschen in Deutschland gewinnen Umwelt- und Klimaschutz immer mehr an Bedeutung. Sie gehen achtsamer mit den Ressourcen um, kaufen bewusster und sind bereit, für den Schutz der Umwelt ihren Lebensstil zu ändern. Seit 1996 erhebt das Umweltbundesamt zusammen mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz eine repräsentative Bevölkerungsumfrage zum Umweltbewusstsein der Menschen. Die Denk- und Handlungsmuster der Deutschen sollen herausgearbeitet und verstanden werden. Die Ergebnisse der Studie sollen die Grundlage für Empfehlungen zu umweltpolitischen Entscheidungen bilden. Die letzte Studie, zu der Ergebnisse vorliegen, stammt von 2022. Im Rahmen der Studie wurden ungefähr 2.000 Personen befragt.
Umwelt- und Klimathemen in Deutschland als wichtige Bestandteile des gesellschaftlichen Bewusstseins
Wie die Ergebnisse der Studie von 2022 zeigen, sind trotz vielfältiger Krisen Umwelt- und Klimathemen fest im gesellschaftlichen Bewusstsein verankert. Ein großer Teil der Bevölkerung ist für Maßnahmen zur Anpassung an Umwelt- und Klimaschutz.
Die Ergebnisse der Befragung sehen folgendermaßen aus:
- für 69 Prozent der Befragten ist der Zustand des Gesundheitssystems ein wichtiges Thema
- der Zustand des Bildungswesens ist für 66 Prozent der Befragten wichtig
- soziale Gerechtigkeit hat für 59 Prozent einen hohen Stellenwert
- Furcht vor Kriegen und Terrorismus spielt für 59 Prozent der Befragten eine wichtige Rolle
- für 57 Prozent der Befragten ist Schutz von Umwelt und Klima ein wichtiges Thema
Beim Schutz von Umwelt und Klima ist gegenüber den vorhergehenden Befragungen ein Rückgang zu verzeichnen. Waren es 2018 noch 64 Prozent und 2020 noch 65 Prozent, für die Umwelt und Klimaschutz einen hohen Stellenwert hatte, so ist die Zahl jetzt auf 57 Prozent zurückgegangen.

Ein großer Teil der Bevölkerung ist für Maßnahmen zur Anpassung an Umwelt- und Klimaschutz | Foto: ©Zamrznuti tonovi #1086686557 – stock.adobe.com
Viele Menschen befürworten umwelt- und klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft
Eine deutliche Mehrheit der Menschen in Deutschland befürwortet der aktuellen Studie zufolge einen Umbau der Wirtschaft nach ökologischen Gesichtspunkten. Von den Befragten sprechen sich 91 Prozent für eine umwelt- und klimafreundliche Wirtschaft aus. Einen positiven Effekt auf die Umweltqualität erwarten 69 Prozent der Befragten. Von den Befragten gehen jeweils 54 Prozent davon aus, dass sich der Umbau der Wirtschaft positiv auf die Gesundheit der Bevölkerung und die Erreichung der Klimaschutzziele auswirken wird. Geht es um die wirtschaftlichen Effekte, sind 35 Prozent überzeugt, dass die Wirtschaft durch den Umbau wettbewerbsfähiger wird. Allerdings befürchten 31 Prozent der Befragten das Gegenteil.
Bei vielen Deutschen führt der Wirtschaftsumbau zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen zu Angst vor einem sozialen Abstieg, Unsicherheit und Sorge um den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Von den Befragten befürchten 74 Prozent durch den ökologischen Wirtschaftsumbau steigende Unterschiede bei Einkommen und Besitz zwischen armen und reichen Menschen. Zunehmende gesellschaftliche Konflikte befürchten 72 Prozent der Befragten.
Mit einem Anstieg der Lebenshaltungskosten aufgrund des umwelt- und klimafreundlichen Umbaus der Wirtschaft rechnen 81 Prozent der Befragten. Verunsichert sind mehr als die Hälfte der Befragten, da sie die Folgen des ökologischen Umbaus der Wirtschaft noch nicht einschätzen können. Angst vor einem sozialen Abstieg durch den Umbau haben 39 Prozent der Befragten.

Eine deutliche Mehrheit der Menschen in Deutschland befürwortet der aktuellen Studie zufolge einen Umbau der Wirtschaft nach ökologischen Gesichtspunkten | Foto: ©Montri #978930473 – stock.adobe.com
Viele Menschen sind für Anpassung der deutlich spürbaren Klimakrise
Die Folgen des Klimawandels sind in Deutschland bereits deutlich spürbar, wie auch die Ergebnisse der Befragung zeigen. Von den Befragten nehmen bereits 85 Prozent den Klimawandel mit Dürre, Trockenheit und Niedrigwasser wahr. Hochwasser, Sturzfluten und Starkregen sind für 83 Prozent der Befragten deutlich spürbar, während für 80 Prozent die Hitze ein Problem darstellt.
Für viele Befragte besteht bei der Anpassung an den Klimawandel großer Handlungsbedarf. Von den Befragten sprachen sich ungefähr zwei Drittel dafür aus, dass der Wasserrückhalt zum Schutz vor Überschwemmungen verbessert werden muss. Die Wälder sollten für zwei Drittel der Befragten zu Mischwäldern umgestaltet werden, die toleranter gegenüber der Trockenheit sind. Einen Bevölkerungsschutz vor Starkregen, Sturzfluten und Hochwasser fordert ungefähr die Hälfte der Befragten. Diese Befragten sprachen sich auch für bauliche Maßnahmen als Schutz vor Überschwemmungen sowie für Gebäudedämmung und eine kühlende Stadtnatur zum Schutz vor Hitze aus.
Die Besorgnis angesichts möglicher Gesundheitsgefahren ist bei der Bevölkerung gewachsen.
Noch 2016 waren nur 59 Prozent der Befragten darüber besorgt, dass sich die Folgen des Klimawandels negativ auf ihre Gesundheit auswirken könnten. Im Jahr 2022 waren bereits 73 Prozent der Befragten angesichts ihrer Gesundheit und der Auswirkungen des Klimawandels besorgt.
Politik ist gefragt
Von den Befragten sind viele dafür, dass Umwelt- und Klimaschutz auch in anderen Bereichen der Politik einen höheren Stellenwert einnehmen. Mehr als die Hälfte der Befragten sprechen sich für eine übergeordnete Rolle von Umwelt- und Klimaschutz in der Landwirtschaftspolitik und der Energiepolitik aus. Sogar ungefähr zwei Drittel erwarten Priorität von Umwelt- und Klimaschutz bei der Energiepolitik. Gegenüber 2020 ist es ein leichter Rückgang, denn da waren es ungefähr 70 Prozent. Von den Studienteilnehmern wünschen sich 55 Prozent der Befragten einen höheren Stellenwert von Umwelt- und Klimabelangen in der Landwirtschaftspolitik. Die Tendenz ist gegenüber 2020 leicht rückläufig, denn da waren es 59 Prozent.
In nahezu allen Bereichen der Politik zeigt sich bei der Studie von 2022 ein leichter Rückgang im Vergleich zu 2020. Weniger als die Hälfte der Teilnehmer sprach sich aktuell dafür aus, dass Umwelt- und Klimaschutz In Stadt- und Regionalplanung und Städtebaupolitik sowie in Verkehrs- und Wirtschaftspolitik eine höhere Gewichtung haben sollte.
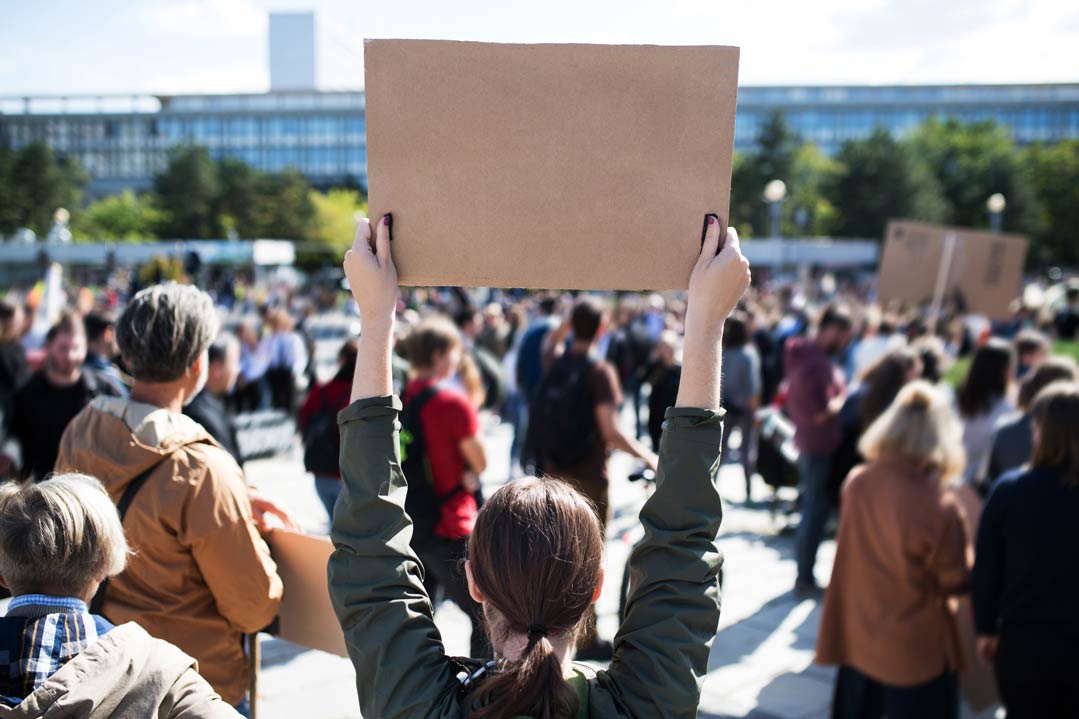
Von den Befragten sind viele dafür, dass Umwelt- und Klimaschutz auch in anderen Bereichen der Politik einen höheren Stellenwert einnehmen | Foto: ©Halfpoint #302002385 – stock.adobe.com
Kritik an der Leistung der relevanten Akteure
Die Befragten sind größtenteils der Meinung, dass die meisten gesellschaftlichen Akteure nicht genug für den Umwelt- und Klimaschutz tun. Die Urteile fallen jedoch 2022 besser als bei den vorangegangenen Studien 2018 und 2020 aus. Aktuell sind 30 Prozent der Studienteilnehmer überzeugt davon, dass die Bundesregierung genug für Umwelt und Klima tut. Das waren 2020 nur 26 Prozent der Befragten.
Anders sieht es bei der Meinung der Befragten zu den Verantwortlichen in den Städten und Gemeinden aus. Der Wert ist im Vergleich zu 2020 auf 27 Prozent im Jahr 2022 gesunken. Das entspricht einem Rückgang um sieben Prozentpunkte. Bei Industrie und Wirtschaft sind die Werte ungefähr gleichgeblieben. Von den Studienteilnehmern glauben 15 Prozent, dass Industrie und Wirtschaft genug tun. Ungefähr 23 Prozent der Teilnehmer glauben, dass die Bürger selbst genug für die Umwelt tun.
Plastikmüll und Verpackungen als zentrales Thema
Eine hohe Priorität hat für 75 Prozent der Teilnehmer an der Studie von 2022 das Thema Plastikmüll. Sie sehen eine zentrale Aufgabe in der Verringerung der Plastikmülleinträge in die Natur. Die Förderung einer Kreislaufwirtschaft ist für 72 Prozent der Befragten wichtig. Rohstoffe und Güter sollten stärker wiederverwertet werden. Wichtig ist ihnen die Förderung einer langen Produktnutzung.
Bundesumweltministerin Steffi Lemke sprach sich für ein rechtlich verbindliches Abkommen gegen die weltweite Plastikvermüllung aus.
Überflüssige Verpackungen sollen vermieden werden. Stattdessen sind ökologisch vorteilhafte Mehrwegverpackungen zu bevorzugen. Die Umweltministerin spricht sich für bessere Rückgabemöglichkeiten für Mehrwegflaschen und ein größeres Angebot an Mehrweg-To-Go-Verpackungen aus.
Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern
Einen grundlegenden Wandel in der Wirtschaft und der Lebensweise im Hinblick auf den Klimawandel halten 18 Prozent der Deutschen nicht für notwendig. Es handelt sich vor allem um Menschen aus einkommensschwächeren Schichten. In anderen europäischen Ländern sind die Menschen bereits sensibler in Sachen Klima und Umwelt. Wie eine 711 Seiten starke Umfrage der Friedrich-Ebert-Stiftung zeigt, die vom Sinus-Institut mit 22.800 Menschen in 19 europäischen Ländern, den USA und Kanada durchgeführt wurde, sind die Menschen nur in Dänemark mit 21 Prozent und in Schweden mit 26 Prozent noch gleichgültiger als in Deutschland. Bewusster sind die Menschen hingegen in Frankreich und Italien, denn nur 13 Prozent halten dort entsprechende Maßnahmen nicht für notwendig. In Spanien sind es sogar nur 9 Prozent.
Von den Deutschen sprechen sich 78 Prozent dafür aus, ihren eigenen Lebensstil zugunsten der Umwelt zu ändern. Auch das ist in Europa ein Tiefstwert. In Großbritannien sind 86 Prozent, in Italien 90 Prozent und in Portugal 94 Prozent zu einer Änderung ihres Lebensstils bereit.



