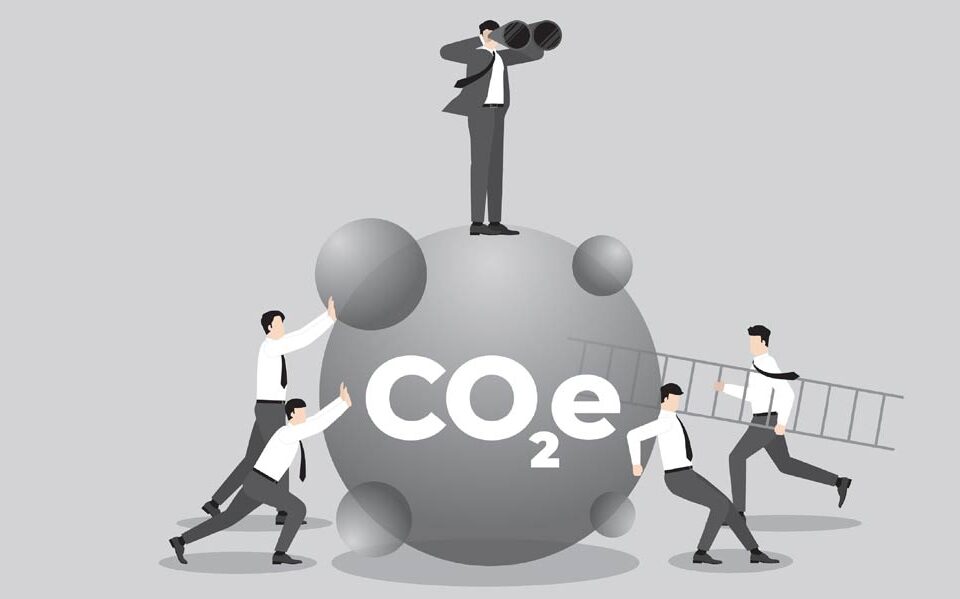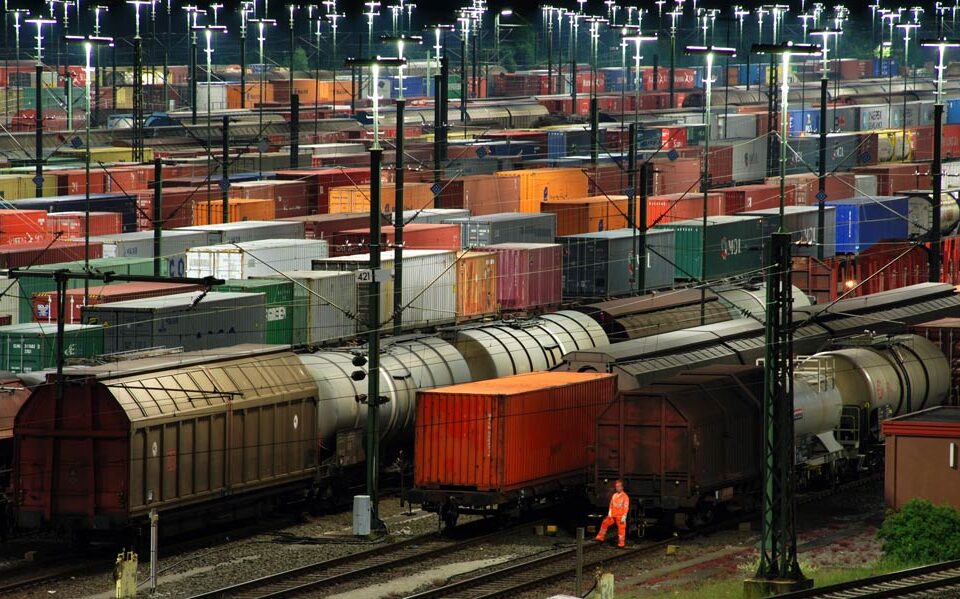Mögliche Auswirkungen von Klimaveränderungen auf die Ausbreitung von primär humanmedizinisch relevanten Krankheitserregern über tierische Vektoren | Foto: ©NuayLub #985433379 – stock.adobe.com
Die Vermehrung und Verbreitung verschiedener Tiere können durch Klimaveränderungen beeinflusst werden. Die Klimaveränderung führt dazu, dass sich verschiedene Tiere verstärkt ausbreiten. Verschiedene dieser Tiere sind Parasiten und daher Krankheitserreger, die beim Menschen, aber auch bei anderen Tieren mitunter schwerwiegende Krankheiten hervorrufen können.
Diese Tiere können jedoch auch Krankheitserreger wie Viren oder Bakterien auf den Menschen übertragen und zur Ausbreitung von primär humanmedizinisch relevanten Krankheitserregern beitragen. Klimaveränderungen können dazu führen, dass sich humanmedizinisch relevante Krankheitserreger über tierische Vektoren verstärkt verbreiten.
Was sind tierische Vektoren?
Klimatische Veränderungen sind für die öffentliche Gesundheit ein wichtiges Thema, denn sie können Erkrankungen des Menschen, die durch Vektor- und Nagetiere übertragen werden, in ihrer Verbreitung beeinflussen. Solche Infektionskrankheiten werden mit hoher Morbidität und Mortalität assoziiert.
Bei den tierischen Krankheitsüberträgern wird zwischen Vektoren und Reservoirtieren unterschieden. Vektoren sind Gliedertiere wie Sand- und Stechmücken oder Zecken. Als Reservoirtiere werden Nagetiere und Vögel bezeichnet. Einige Nagetiere wie Rötelmäuse können direkt Krankheitserreger auf den Menschen übertragen. Rötelmäuse sind Überträger des Hantavirus.
Klimatische Faktoren wie erhöhte Temperaturen oder Niederschläge beeinflussen die Verbreitung von Reservoirtieren und von Vektoren.
Beispiele für Krankheitserreger, die durch tierische Vektoren übertragen werden, sind Bakterien wie die Erreger der Lyme-Borreliose, Viren wie die Erreger von Dengue-Fieber oder FSME oder ein- und mehrzellige Parasiten. Nach Paragraf 7 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) sind viele der durch Vektoren übertragenen Erkrankungen meldepflichtig. Das Auftreten der Vektoren und Krankheitserreger verdient im Hinblick auf den Klimawandel verstärktes Augenmerk. Die veränderten Klimabedingungen in Europa können zum Auftreten neuer Vektoren und Krankheitserreger führen.
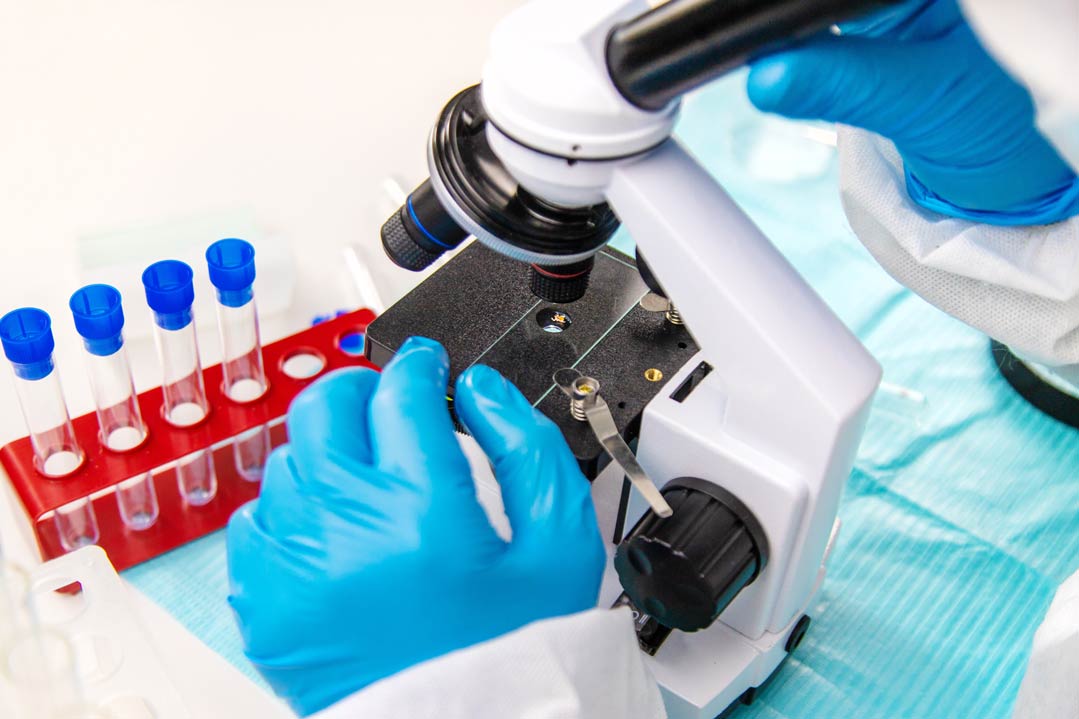
Beispiele für Krankheitserreger, die durch tierische Vektoren übertragen werden, sind Bakterien wie die Erreger der Lyme-Borreliose, Viren wie die Erreger von Dengue-Fieber oder FSME oder ein- und mehrzellige Parasiten | Foto: ©yanadjan #1374637598 – stock.adobe.com
Voraussetzungen für das epidemische Auftreten von vektorassoziierten Erkrankungen
Damit sich eine vektorassoziierte Erkrankung epidemisch oder endemisch ausbreiten kann, muss ein kompetenter Vektor vorhanden sein. Für die Entwicklung der Krankheitserreger, die diesen Vektor als Zwischenwirt benutzen, ist häufig eine Mindesttemperatur erforderlich. Oft besteht zwischen steigenden Temperaturen und der Entwicklungsgeschwindigkeit solcher Krankheitserreger eine positive Korrelation. Diese Temperatur darf das Optimum jedoch nicht überschreiten, damit sich die Krankheitserreger entwickeln. Zusätzlich müssen mit Krankheitserregern infizierte Wirte vorhanden sein, an denen sich die Vektoren infizieren. Diese Wirte werden als Reservoirwirte bezeichnet und können Menschen, aber auch Haus- und Wildtiere sein.
Vektoren nehmen die Krankheitserreger auf, indem sie bei den Reservoirwirten Blut saugen. Im Körper der Vektoren entwickeln sich die Krankheitserreger und können wieder auf den Menschen übertragen werden. Nicht alle Vektortiere übertragen die Krankheitserreger beim Blutsaugen. Einige Vektoren suchen auch die Umgebung oder die Nahrungsmittel der Menschen auf und kontaminieren sie mit den Krankheitserregern.

Im Körper der Vektoren entwickeln sich die Krankheitserreger und können wieder auf den Menschen übertragen werden | Foto: ©shishiga #85207907 – stock.adobe.com
Beeinflussung der Vektorverbreitung und -kompetenz durch Klimaveränderungen
Aufgrund der Hitze im Sommer 2003 gab das Umweltbundesamt beim Institut für Medizinische Parasitologie der Universität Bonn eine Studie zu den möglichen Auswirkungen der Klimaveränderungen auf die Verbreitung von humanmedizinisch relevanten Krankheitserregern über tierische Vektoren in Auftrag. In der Studie beschreiben die Wissenschaftler die Beeinflussung der Vektorverbreitung und -kompetenz durch Klima und Temperatur. Die Temperatur ist ein wichtiger Faktor für die Entwicklungsgeschwindigkeit von Pathogenen und Vektoren.
Sind die Temperaturen zu hoch, kann die Entwicklung beider Systemkomponenten gehemmt werden.
Ansteigende Temperaturen und sinkende Luftfeuchtigkeit können die Lebensdauer der Vektoren deutlich verkürzen, sodass die Krankheitserreger nicht mehr übertragen werden können. Um vorherzusagen, wie sich Temperaturerhöhungen auf die Ausbreitung vektorbedingter Erkrankungen auswirken, muss die Bionomie der Systemkomponenten bekannt sein. Es hängt von der Art der Vektoren und der Krankheitserreger ab, wie stark sich Klimaveränderungen auf die Verbreitung auswirken.
Zu erwartende Auswirkungen von Klimaveränderungen auf Vektoren und Krankheitserreger
Die Transmissionsrate von Krankheitserregern wie Bakterien und Viren kann sich bei steigenden Temperaturen verändern. Bei besseren Lebensbedingungen können sich sowohl die Vektoren als auch die Krankheitserreger stärker vermehren. Die Populationsdichte kann sich auch bei den Reservoirtieren erhöhen.
Möglich ist auch eine Veränderung der jährlichen Aktivitätsperioden bei den Vektoren. Die Vektoren haben in milderen Wintern höhere Überlebenschancen. Das Etablierungs- und Verbreitungspotenzial von neuen, eingeschleppten Vektoren und Krankheitserregen steigt bei höheren Temperaturen.

Die Transmissionsrate von Krankheitserregern wie Bakterien und Viren kann sich bei steigenden Temperaturen verändern | Foto: ©yanikap #213527503 – stock.adobe.com
Bereits eingetretene Auswirkungen von Klimaveränderungen auf Vektoren
Die folgenden Beispiele zeigen, wie sich Klimaveränderungen auf Vektoren und die von ihnen übertragenen Krankheitserreger auswirken können. Die beschriebenen Auswirkungen sind bereits eingetreten.
Auswirkung auf den Gemeinen Holzbock
Die Schildzeckenart Ixodes ricinus, der Gemeine Holzbock, ist ein deutschlandweit verbreiteter Vektor. Er findet in Deutschland ideale Lebensbedingungen und kann verschiedene Infektionserreger wie Rickettsia, Borrelia oder FSME übertragen. Das Umweltbundesamt hat verschiedene Forschungsprojekte zur Untersuchung des Vorkommens und der Aktivität von Schildzecken in Deutschland unter den Bedingungen des Klimawandels in Auftrag gegeben.
Die Überwinterung und die Aktivitätsperiode der Zecken werden durch mikro- und makroklimatische Faktoren beeinflusst. Aktive Zecken wurden auch in wärmeren Herbst- oder Wintermonaten nachgewiesen.
Auswirkung der Klimaveränderungen auf Stechmückenarten
Ein weiteres Beispiel für bereits eingetretene Auswirkungen von Klimaveränderungen auf Vektoren sind Stechmücken. Werden sie aus ihren ursprünglichen Verbreitungsgebieten verschleppt und finden sie geeignete Bedingungen vor, können sie sich neu ansiedeln. Der Japanische Buschmoskito Aedes japonicus japnicus hat seinen Ursprung in den nördlichen Gebieten Japans und Koreas. Er wurde durch den internationalen Warenhandel verschleppt und breitete sich in Nordamerika und Zentraleuropa aus. Innerhalb kurzer Zeit konnte sich diese Stechmückenart auch in Deutschland ausbreiten und etablieren. Diese Stechmückenart ist potenzieller Überträger der Japan-Enzephalitis, des West-Nil-Virus und des La-Crosse-Virus. Das Übertragungspotenzial und die gesundheitliche Bedeutung werden im Freiland als vergleichsweise gering beschrieben.
Die Asiatische Tigermücke Aedes albopictus hat ein hohes Vektorpotenzial für verschiedene humanpathogene Viren wie das Chikungunya-Virus (CHIKV) oder das Dengue-Virus.
Sie ist extrem anpassungsfähig an neue klimatische Bedingungen. Die Stechmücke ist im südostasiatischen Raum beheimatet und gehört zu den 100 invasivsten Arten weltweit. Sie ist die invasivste bekannte Stechmückenart. Adulte Tiere dieser Art wurden im Sommer 2012 an Autobahnen in Bayern und Baden-Württemberg gefunden. Inzwischen konnte sich die Asiatische Tigermücke an verschiedenen Orten in Deutschland etablieren. Für einen Krankheitsausbruch wird die Populationsdichte jedoch an den meisten Orten in Deutschland als zu gering eingeschätzt.
Das aus Afrika stammende West-Nil-Virus hat sich in den letzten Jahrzehnten stark ausgebreitet und wird auch von der in Deutschland weit verbreiteten Stechmückengattung Culex übertragen. In Deutschland wurde eine Zirkulation des Virus erstmals im Jahr 2018 nachgewiesen. Die ersten menschlichen autochthonen Infektionen wurden in Deutschland 2019 diagnostiziert und sind vermutlich auf eine Übertragung durch Mücken zurückzuführen. Infektionsfälle treten insbesondere in heißen Sommern auf.
Auswirkungen von klimatischen Veränderungen auf Sandmücken
Sandmücken treten in tropischen, subtropischen und gemäßigten Gebieten auf und sind in Europa vorrangig im mediterranen Bereich anzutreffen. Sie können die Erreger der Leishmaniose übertragen, die für Säugetiere gefährlich sind. Die Infektion wird durch die einzelligen Parasiten der Gattung Leishmania übertragen und tritt insbesondere bei Hunden, Wölfen, Füchsen und Nagetieren auf. Durch infizierte Hunde aus endemischen Gebieten können die Erreger auch nach Deutschland eingeschleppt werden. In Deutschland wurde bislang noch keine autochthone Übertragung auf den Menschen nachgewiesen.
Die Jahresisothermie von 10 Grad Celsius wird als nördliche Verbreitungsgrenze für Sandmücken angenommen. Dabei handelt es sich um eine gedachte Linie zwischen Regionen mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von 10 Grad Celsius. Diese Linie verläuft in Deutschland ungefähr bei Köln und kann sich in warmen Jahren bis nach Hamburg verschieben. Ein Temperaturanstieg könnte zu einer verstärkten Vermehrung von Sandmücken in Deutschland führen. Das Verbreitungsgebiet dieser Vektoren könnte sich bis nach Norddeutschland ausbreiten.