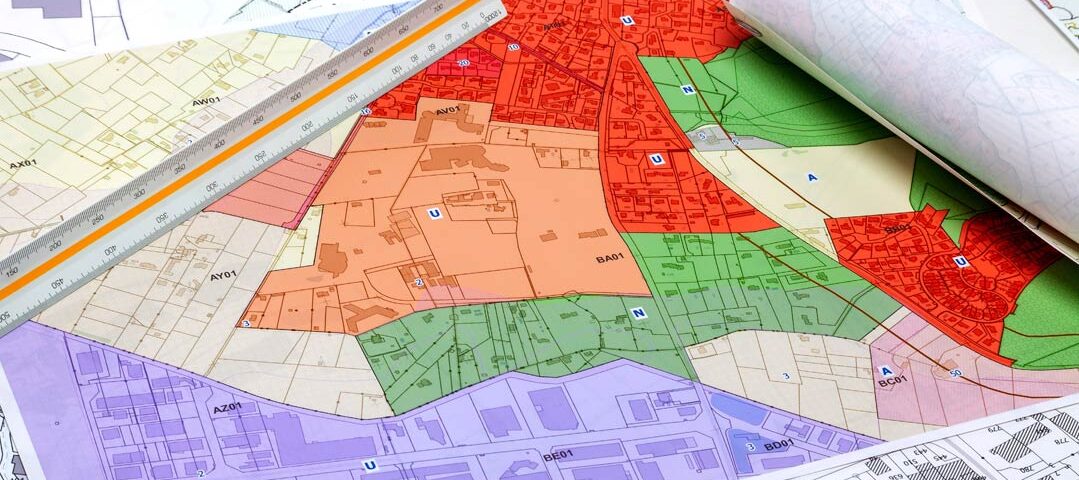
Umweltschutz im Planungsrecht | Foto: ©Olivier-Tuffé #397047273 – stock.adobe.com
Das Planungsrecht ist ein zentraler Baustein im Kampf für den Umweltschutz. Eigeninitiative und Umweltbewusstsein reichen lange nicht mehr aus, um die Folgen des Klimawandels einzudämmen. Dort, wo der Staat die Möglichkeiten hat, gezielt einzugreifen, liegen die goldenen Chancen für unsere Umwelt. Mit dem Planungsrecht schafft der Staat die Voraussetzungen für eine umweltfreundliche Zukunft. Doch wie genau funktioniert der Umweltschutz im Planungsrecht und wo liegen die Möglichkeiten zur Rettung des Klimas?
Planungsrecht – Bedeutung und Funktion für die Umwelt
Unser Boden ist eine der natürlichsten Ressourcen. Auf ihm wächst unser Gemüse und Obst, hier betreiben wir Landwirtschaft und Viehzucht, und auch unsere Städte und Straßen bauen wir auf ihm. Dabei werden etwa 50 % der Fläche landwirtschaftlich genutzt, Wälder nehmen circa 30 % ein und 14,5 % werden für Wohn- und Gewerbeflächen sowie Straßen verwendet. Mit einem immer größeren Bevölkerungszuwachs und der steigenden Wohnungsnot scheint der Ausbau neuer Wohn- und Gewerbeflächen jedoch unabdingbar.
Dafür haben wir verschiedene Möglichkeiten. Entweder bebauen wir das Land, wie in den letzten Jahrhunderten, ohne Rücksicht auf die Natur und riskieren damit Hochwasser, Luftverschmutzung, Hitzewellen und das Sterben unser Arten. Oder wir machen das auf die umweltfreundliche Art und sorgen so für eine funktionierende Zukunft vor.
Ein Großteil der Bauprojekte wird jedoch von privater Hand geführt. Das bedeutet, dass die Vorhaben finanzielle Zwecke verfolgen und der Umweltschutz in den Hintergrund gerät.
Projekte, die umweltschonend umgesetzt werden, sind meist teurer, weshalb wir nicht davon ausgehen können, dass freiwillig umweltschonend gebaut wird.
Genau hier greift das Planungsrecht ein. Darunter verstehen wir den staatlichen Ordnungsrahmen, der Vorschriften zur Bebauung von Flächen angibt. Dabei bestimmt der Staat unteranderem wo gebaut werden darf, oder in welchem Abstand Industrieanlagen zu Wäldern stehen dürfen. Das macht den Staat zu einem bedeutenden Spieler im Kampf für den Umweltschutz.

Das Planungsrecht ist der staatliche Ordnungsrahmen mit Vorschriften zur Flächenbebauung | Foto: ©U. J. Alexander #203390587 – stock.adobe.com
Wie geht Umweltschutz im Planungsrecht?
Das deutsche Planungsrecht hat sich anfangs der 2000er zur Aufgabe gemacht, die Umwelt zu schützen. Dabei wird zwischen den beiden Attributen Klimaschutz und Biodiversität unterschieden. Durch verschiedene Standartsetzungen und Regelungen soll beides im Bau garantiert werden. Das beginnt schon bei der Planung von neuen Objekten. Hier gibt es bestimmte Vorschriften, die von Bauherren, Architekten und Gutachtern eingehalten werden müssen.

Das deutsche Planungsrecht hat sich anfangs der 2000er zur Aufgabe gemacht, die Umwelt zu schützen | Foto: ©ah_fotobox #1176004565 – stock.adobe.com
Der Klimaschutz im Planungsrecht
Eines der Kernziele des Klimaschutzes im Planungsrecht ist der Ausbau erneuerbarer Energien. Gemäß des § 1 des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien wurde sich Anfang der 2000er zum Ziel gesetzt, den Anteil sauberer Energien bis 2020 auf 20 % ansteigen zu lassen. Um das Ziel in die Realität umzusetzen, greift das Planungsrecht mit bestimmten Regelungen ein. Dafür wurden beispielsweise Netzbetreiber verpflichtet Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien vorrangig an ihr Netz anzuschließen. Im Jahr 2020 konnte Deutschland sogar einen Anteil an erneuerbaren Energien von 38,5 % erzeugen, und bewies so, dass das Planungsrecht ein effektives Mittel im Kampf für den Klimaschutz ist.
Ein weiteres Ziel befasst sich mit der Energieeinsparung und Effizienzsteigerung.
Auch dafür wurde ein Gesetz im Planungsrecht entworfen. Das Energiewirtschaftsgesetz, kurz EnWG schreibt vor, dass jedes Gebäude, das zweckmäßig erhitzt oder gekühlt werden muss, unnötigen Energieaufwand konsequent verhindern muss. Um dies einzuhalten wurden Energiesparverordnungen erlassen, die gewisse Grenzwerte festlegen und Strafen vorschreiben.
Neben unsauberer Wärme- und Energiegewinnung stellt die Freisetzung von Methan eine der größten Belastungen für die Umwelt dar. Durch die Oxidation zu Kohlenstoff schadet Methan der Atmosphäre erheblich und trägt zur Erderwärmung bei. Auch hier greift das Planungsrecht mit klaren Richtlinien ein. Da ein Großteil des Methans durch die Rinderzucht entsteht, betreffen die Maßnahmen hauptsächlich die Landwirtschaft. Dies gelingt über die Eingrenzung der Maximalfläche zur Viehzucht oder eine vorgeschriebene Distanz zwischen verschiedenen Zuchtbetrieben.
Darüber hinaus sind CO₂-Senken im Umweltschutz entscheidend. Diese natürlichen Räume binden Kohlenstoff und verhindern, dass sich der klimaerwärmende Stoff in der Atmosphäre ansammelt. In Deutschland sind das vor allem Wälder und Moore. Durch das Planungsrecht wird verhindert, dass diese wichtigen Gebiete durch Bebauung verschwinden.
Schutz der Biodiversität
Eine weitere Aufgabe liegt im Schutz der Arten. Durch die willkürliche Bebauung gehen wichtige Lebensräume verloren. Arten, die wichtig für heimische Ökosysteme sind, verschwinden und bedrohen damit weitere Lebewesen. Darüber hinaus sind einige Arten durch die rücksichtslose Bebauung sogar ganz vom Aussterben bedroht. Auch hier das hat Planungsrecht einige lebensrettende Maßnahmen gefunden.
Grundlegend für den Erhalt der Arten ist der Gebietsschutz. Dabei bleiben bestimmte Gebiete einer Bebauung oder landwirtschaftlichen Nutzung fern. Grundsätzlich darf hier nicht gebaut werden. Natürliche Ökosysteme sollen erhalten bleiben und die Natur sich wie gehabt frei entfalten. Typische Beispiele sind Nationalparks, Biosphärenreservate, Landschaftsschutzgebiete und der Schutz von Gewässern und Uferzonen. Wer regelmäßig in der Natur unterwegs ist, wird so eine Kennzeichnung bestimmt schon mal gesehen haben. Hier schränkt der Mensch seinen Expansionswillen zugunsten der Natur ein und gibt den Arten ihren Lebensraum zurück.
Da bestehende Grünflächen und natürliche Zonen jedoch meist getrennt voneinander existieren und zwischen ihnen bebaute Flächen liegen, bieten sich auch hier Gefahren für die Artenvielfalt. Eine Trennung natürlicher Ökosysteme verhindert es, dass die Arten ihrem Lebensrhythmus nachgehen und sich frei entfalten können. Mit Biotopverbünden versucht man dem entgegenzuwirken und künstlich voneinander getrennte Lebensräume wieder zu vereinen. Ein klassisches Beispiel dafür ist das Wanderverhalten von Fröschen. Biotopverbünde schaffen Verbindungsflächen, die eine gefahrenlose Wanderung ermöglichen. Im Planungsrecht werden dafür bestimmte Flächen von der Bebauung ausgeschlossen.
Ebenso geht der Artenschutz im Planungsrecht auf die Eigenheiten der Arten ein.
Vor allem Vögel reagieren in ihren Brut- und Aufzuchtzeiten besonders empfindlich auf laute Geräusche. Das Planungsrecht schränkt den Bau bestimmter Vorhaben, wie Flughäfen nahe dem Lebensraum gewisser Tiere ein.
Darüber hinaus dient die sogenannte Landschaftsplanung als Kontrollinstanz des Umweltschutzes im Planungsrecht. Hier werden die konkreten Ziele und Pläne des Artenschutzes festgestellt und wissenschaftlich untersucht. Alle anderen Maßnahmen und Regelungen, die eingesetzt werden unterliegen diesen Vorstellungen.

Eine weitere Aufgabe liegt im Schutz der Arten | Foto: ©Maren Winter #357951305 – stock.adobe.com
Ist der Eingriff gerechtfertigt?
Wie so oft stellt sich die Frage, ob ein derartiger Eingriff von staatlicher Seite übermäßig in die Freiheit des Menschen eingreift. Die Bestimmungen und Kontrollen führen zu einem hohen Kosten- und Zeitaufwand. Dort wo, wirtschaftliche Zentren entstehen und Arbeitsplätze geschaffen werden könnten, wird ein Bau durch das Planungsrecht häufig verhindert. Aus diesen Gründen sehen viele Bürger ein Problem im umweltfreundlichen Planungsrecht und verstehen die Eingriffe unverhältnismäßig.
Betrachtet man aber die Ergebnisse des Planungsrechts, wird deutlich, wie wichtig die Maßnahmen für den Umweltschutz der letzten Jahre waren.
Nicht nur haben sie für ein enormes Bewusstsein in der Bevölkerung geführt, auch haben sie dazu beigetragen Deutschland zu einem der grünsten Länder der Erde zu machen. So hat beispielsweise das Gesetz zum Vorrang Erneuerbarer Energiegewinnung grundlegend zu der enorm hohen Quote beigetragen, die wir heute haben. Auch ziehen Maßnahmen wie die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) wichtig Umweltaspekte bei jedem Neubau hinzu.
Das Planungsrecht hat weitreichende Flächen gerettet. So bleibt nicht nur etlichen Arten ein zu Hause, auch bieten sich grüne Rückzugsorte für Menschen, die sich einen Ausflug in die Natur wünschen. Fernab von den Betonriesen der Großstadt finden sie hier einen Ruheort und schaffen ihrer Psyche eine Auszeit vom hektischen, oft überfordernden Alltag. Deutschland behält seine Wälder und Wiesen und bleibt ein Ort natürlicher Schönheit. Sicher gibt es bauliche Vorhaben, die durch das umweltfreundliche Planungsrecht nicht zu Stande gekommen sind oder deutlich teurer wurden. Im Gegensatz zu ihrer Zerstörung ist die Rettung der Erde jedoch kein kostenloses Unterfangen und fordert gewisse Kompromissbereitschaft.
Fazit
Das Planungsrecht im Umweltschutz ist eine effektive Methode, sowohl Klima- als auch Artenschutz voranzutreiben. Mit Regelungen zur Energiegewinnung, der Reduzierung von Methanemissionen und dem Erhalt natürlicher CO₂-Speicher trägt das Planungsrecht zum Erhalt der Natur bei.
Auch die bedrohte Artenvielfalt konnte sich durch geschützte Gebiete, Biotopenverbünde, Artenschutz und kontrollierter Landschaftsplanung nachweislich erholen. Mit dem Umweltschutz im Planungsrecht sind wir dem gemeinsamen Ziel der Rettung der Erde schon deutlich näher gekommen.



